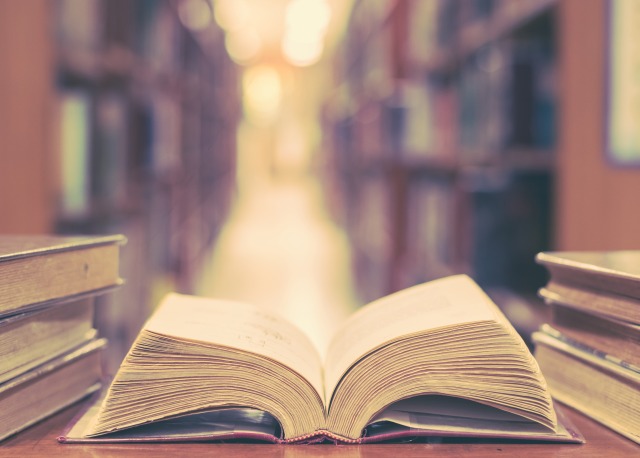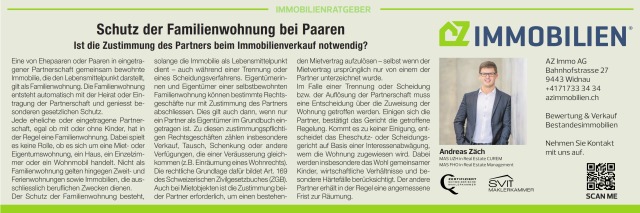Schutz der Familienwohnung bei Paaren
Ist die Zustimmung des Partners beim Immobilienverkauf notwendig?
Eine von Ehepaaren oder Paaren in eingetragener Partnerschaft gemeinsam bewohnte Immobilie, die den Lebensmittelpunkt darstellt, gilt als Familienwohnung. Die Familienwohnung entsteht automatisch mit der Heirat oder Eintragung der Partnerschaft und geniesst besonderen gesetzlichen Schutz.
Jede eheliche oder eingetragene Partnerschaft, egal ob mit oder ohne Kinder, hat in der Regel eine Familienwohnung. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um eine Miet- oder Eigentumswohnung, ein Haus, ein Einzelzimmer oder ein Wohnmobil handelt. Nicht als Familienwohnung gelten hingegen Zweit- und Ferienwohnungen sowie Immobilien, die ausschliesslich beruflichen Zwecken dienen.
Der Schutz der Familienwohnung besteht, solange die Immobilie als Lebensmittelpunkt dient – auch während einer Trennung oder eines Scheidungsverfahrens. Eigentümerinnen und Eigentümer einer selbstbewohnten Familienwohnung können bestimmte Rechtsgeschäfte nur mit Zustimmung des Partners abschliessen. Dies gilt auch dann, wenn nur ein Partner als Eigentümer im Grundbuch eingetragen ist. Zu diesen zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften zählen insbesondere Verkauf, Tausch, Schenkung oder andere Verfügungen, die einer Veräusserung gleichkommen (z.B. Einräumung eines Wohnrechts). Die rechtliche Grundlage dafür bildet Art. 169 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB).
Auch bei Mietobjekten ist die Zustimmung beider Partner erforderlich, um einen bestehenden Mietvertrag aufzulösen – selbst wenn der Mietvertrag ursprünglich nur von einem der Partner unterzeichnet wurde.
Im Falle einer Trennung oder Scheidung bzw. der Auflösung der Partnerschaft muss eine Entscheidung über die Zuweisung der Wohnung getroffen werden. Einigen sich die Partner, bestätigt das Gericht die getroffene Regelung. Kommt es zu keiner Einigung, entscheidet das Eheschutz- oder Scheidungsgericht auf Basis einer Interessenabwägung, wem die Wohnung zugewiesen wird. Dabei werden insbesondere das Wohl gemeinsamer Kinder, wirtschaftliche Verhältnisse und besondere Härtefälle berücksichtigt. Der andere Partner erhält in der Regel eine angemessene Frist zur Räumung.
Zur Ansicht des Originalbeitrags im Rheintaler Bote klicken Sie hier.